Rabattmarken:
Warum kleine Anlässe grosse Gefühle auslösen
Vielleicht haben Sie es bei sich oder anderen schon erlebt: Eine Person ärgert sich über eine Kleinigkeit – und plötzlich explodiert sie wie ein Vulkan. Der Auslöser ist oft banal, der eigentliche Grund liegt jedoch in aufgestauten Gefühlen. Die Transaktionsanalyse liefert dafür ein anschauliches Modell: Die Rabattmarken.
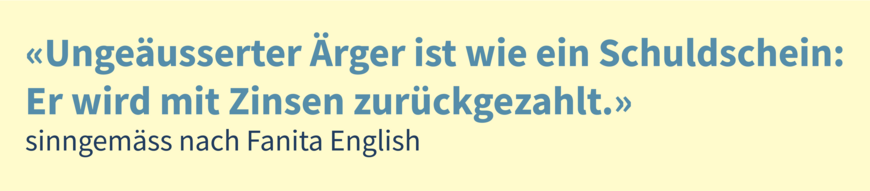
Eric Berne hat das Rabattmarkenmodell entwickelt, später wurde es durch Fanita English verfeinert und erweitert. Bei diesem Modell handelt es sich um eine Metapher: wie im Supermarkt sammelt man Rabattmarken und klebt sie in ein Heft. Ist eine Seite voll, gibt es eine kleine Prämie. Ist das ganze Heft voll, winkt eine grosse Trophäe.
Anders als im Supermarkt findet das Sammeln beim Rabattmarken-Modell meist unbewusst statt. Bei der Übertragung dieser Metapher auf menschliches Verhalten folgerte Eric Berne: Belastende Gefühle werden nicht im Moment ausgedrückt, sondern aufgestaut oder eben eingeklebt (vgl. auch Stewart, I & Joines, V.). So wird eine Irritation beispielsweise verschwiegen und «runtergeschluckt», statt dass sie angesprochen würde. Oder Traurigkeit wird hinter einem Lächeln verborgen.
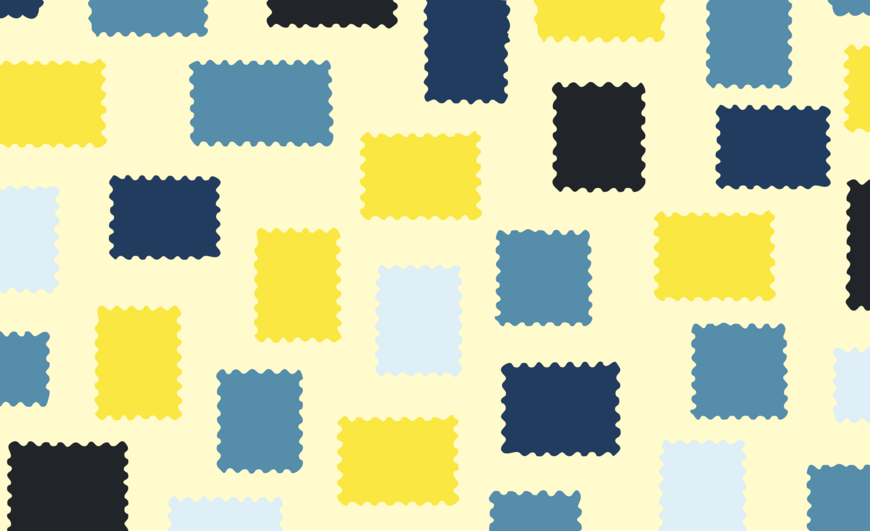
Irgendwann ist eine Seite oder das ganze Heft voll. Die Sammlung unausgesprochener Gefühle führt zu wachsender innerer Anspannung und steigendem Druck. Je nach Persönlichkeit, biografischen Erfahrungen und erlernten Mustern erfolgt das «Einlösen» unterschiedlich – mal seitenweise, mal erst, wenn das ganze Heft gefüllt ist. Entsprechend gross ist die Wucht, mit der sich die angestauten Gefühle entladen: etwa in Form von explosivem Verhalten oder radikalem Rückzug. Darunter leiden Beziehungen nachhaltig. Missverständnisse, Konflikteskalationen und Entfremdung sind mögliche Folgen.
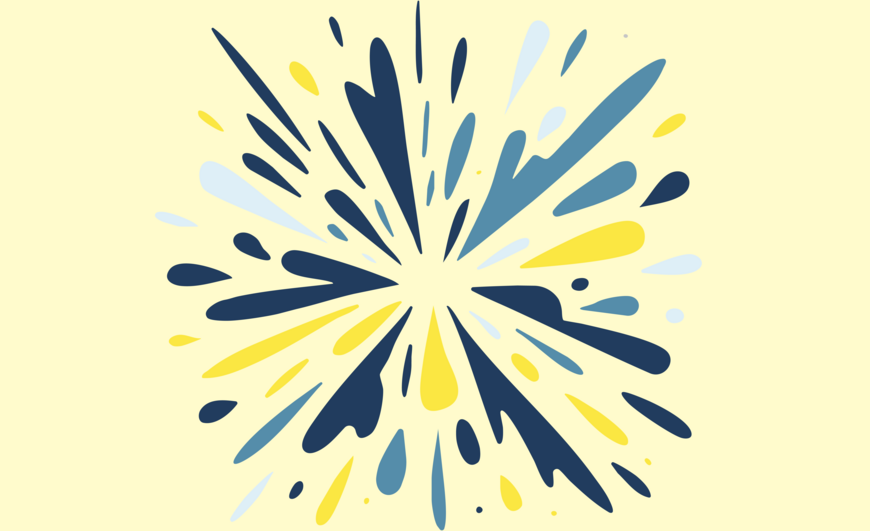
Weshalb sammeln wir Menschen dennoch solch destruktive Rabattmarken? Welche «guten Gründe» gibt es für das Einkleben bis hin zum Einlösen von verletzenden Prämien und zerstörenden Trophäen?
- Angst vor Konflikten («Wenn ich meinen Ärger zeige, verliere ich Zuneigung»),
- erlernte Muster («In unserer Familie wird nicht gestritten»),
- soziale Regeln («Höflichkeit um jeden Preis») sowie
- kurzfristige Spannungsvermeidung gehören mitunter dazu.
Beim Einkleben arbeiten wir oft unbewusst auf eine spätere Auszahlung im Sinne einer Skriptbestätigung hin. Beim Einlösen halten wir unsere heftige Reaktion dann für gerechtfertigt. Wir empfinden beispielsweise, dass das Gegenüber die Reaktion «verdient» habe – übersehen dabei jedoch, dass diese Person meist gar nichts mit den zuvor angesammelten Kränkungen zu tun hat.
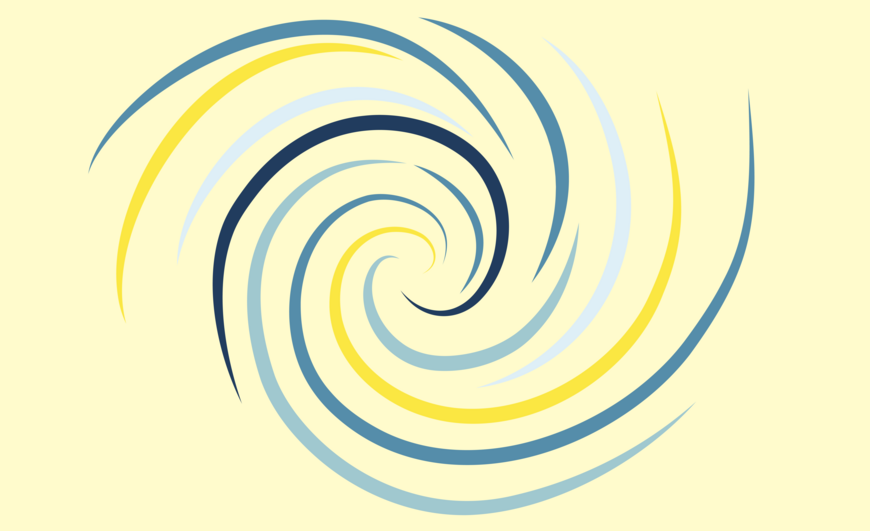
Drücken wir unsere Gefühle aus – für lebendigere Beziehungen!
Statt Rabattmarken zu sammeln und destruktiv einzulösen, zeigt uns das Modell auch Wege, wie wir präventiv mit uns selbst und anderen umgehen können. Hilfreiche Fragen und inspirierende Anregungen hierzu finden Sie in unserem Übungsplatz.
Als Fazit wünsche ich uns ein bewusstes, zuMUTendes Miteinander, ganz nach dem «Motto»: Lebst du schon – oder klebst du noch?
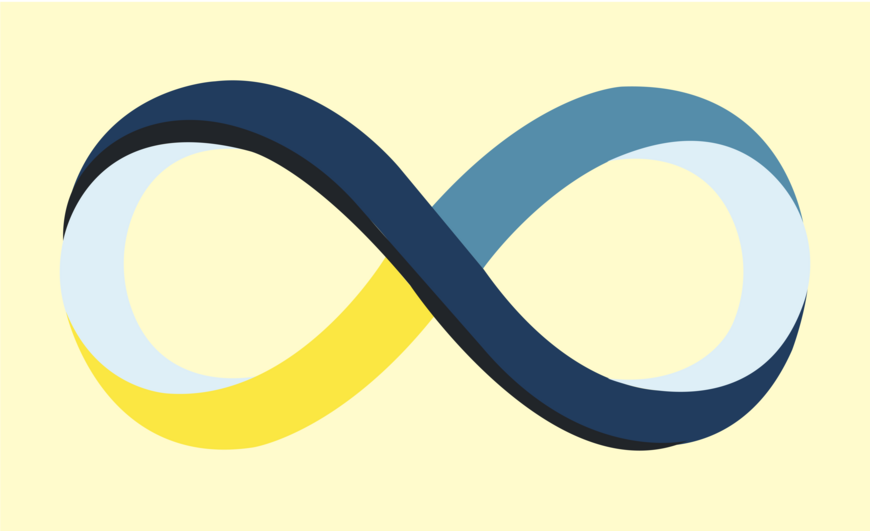
Quellen:
- Gührs, M. & Nowak, C. (2018), Ein Übungsbuch zum konstruktiven Gespräch (4. Aufl.), Meezen: Limmer
- Stewart, I. & Joines, V. (2023), Die Transaktionsanalyse, Eine Einführung, Freiburg: Herder
- Röhl, S. (2020), Fanita English, Ein Leben mit der Transaktionsanalyse (3. Aufl.), Salzhausen: iskopress
- Die Abbildungen wurden mithilfe von fobizz (KI) erstellt
Verfasst von Magaly Heller, Kursleiterin TA Schweiz
